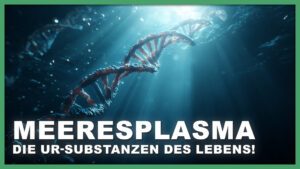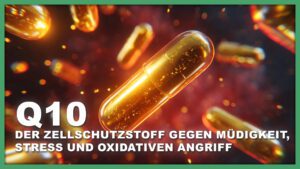Die Mammographie wird von vielen Frauen als wichtige Maßnahme zur Krebsfrüherkennung betrachtet. Doch was, wenn dieses Verfahren mehr Schaden als Nutzen bringt? Was, wenn die Mammographie Frauen nicht schützt, sondern sie krank macht? Der folgende Artikel beleuchtet genau diese Fragen. Dabei wird aufgezeigt, warum die Mammographie zunehmend in die Kritik gerät und weshalb immer mehr Fachleute ihre Anwendung infrage stellen. Die Fokus-Keyphrase Mammographie steht im Zentrum dieser Analyse.
➥ Autor: Jana Witschetzky
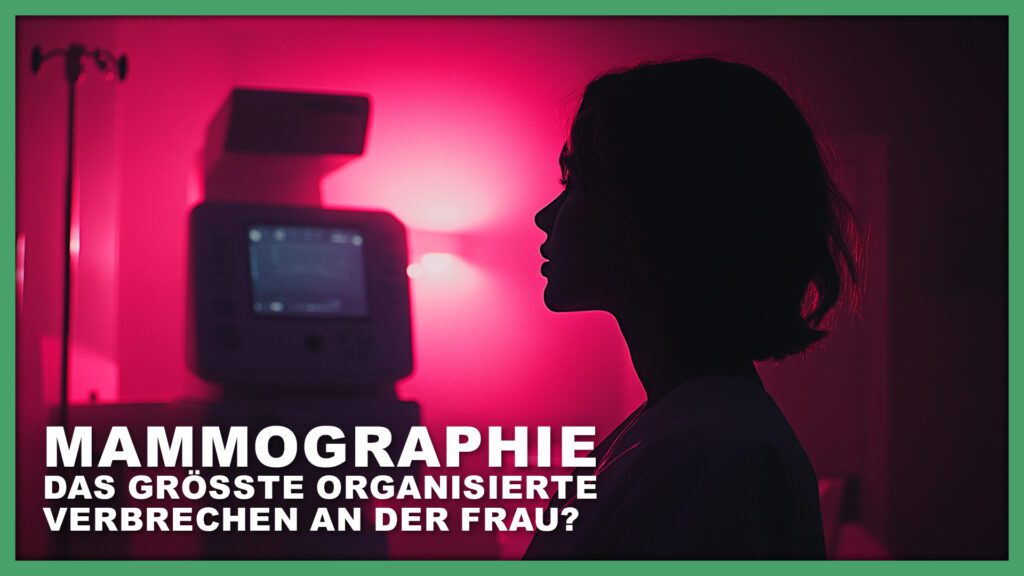
Was passiert bei einer Mammographie?
Bei der Mammographie wird die weibliche Brust zwischen zwei Platten stark zusammengepresst. Anschließend wird sie mit Röntgenstrahlen durchleuchtet. Das Ziel dieser Prozedur ist es, potenzielle Tumore frühzeitig zu erkennen. Doch diese Früherkennungsmethode bringt viele Risiken mit sich. Denn das empfindliche Gewebe der Brust wird nicht nur mechanisch belastet, sondern zusätzlich mit ionisierender Strahlung bombardiert. Diese Strahlung kann Zellen beschädigen und langfristig das Risiko für Krebserkrankungen erhöhen.
Die Mammographie wirkt auf viele Frauen harmlos. Sie glauben, sich und ihrer Gesundheit damit etwas Gutes zu tun. Doch zahlreiche Studien zeigen, dass die Realität anders aussieht. In der Praxis ist die Mammographie ein Verfahren mit einer hohen Fehleranfälligkeit und potenziell gefährlichen Nebenwirkungen.
Falschdiagnosen: Wenn Angst zur Diagnose wird
Ein zentraler Kritikpunkt an der Mammographie ist die hohe Zahl falsch-positiver Ergebnisse. Zwischen 50 und 60 Prozent aller positiven Befunde erweisen sich im Nachhinein als falsch. Das bedeutet, dass mehr als jede zweite Frau, die eine Krebsdiagnose erhält, tatsächlich gesund ist. Diese Fehlalarme haben weitreichende Folgen. Sie führen zu unnötigen Operationen, belastenden Therapien und seelischem Stress.
Darüber hinaus stellt sich die Frage, warum ein Verfahren mit einer so hohen Fehlerquote noch immer standardmäßig empfohlen wird. Die Mammographie scheint eher Ängste zu schüren als Sicherheit zu schaffen. Für viele Frauen beginnt mit der Untersuchung ein langer Leidensweg – ohne tatsächlichen medizinischen Grund.

Körperliche Schäden durch mechanischen Druck
Die mechanische Belastung, die bei einer Mammographie auf das Brustgewebe ausgeübt wird, ist erheblich. Der Druck beträgt etwa 10 kPa, was über 1.000 Kilogramm pro Quadratmeter entspricht. Dieses Maß an Kompression ist für das empfindliche Milchdrüsengewebe eine massive Belastung. Vor allem bei wiederholten Untersuchungen kann dies zu Mikroverletzungen führen. Diese werden von vielen Fachleuten mit der möglichen Entstehung oder Förderung von Tumoren in Verbindung gebracht.
Viele Frauen berichten nach der Mammographie über Schmerzen oder Beschwerden. Das wird oft als „normal“ abgetan. Doch was, wenn genau diese Belastung langfristige Folgen hat? Was, wenn die Mammographie selbst zum Auslöser für Zellveränderungen wird?
Strahlung als Risiko – nicht als Schutz
Die Mammographie setzt auf Röntgenstrahlen. Diese sind nachweislich genotoxisch. Das bedeutet: Sie können das Erbgut verändern. Während bei akuten Beschwerden häufig darauf geachtet wird, die Strahlendosis gering zu halten, wird bei der Mammographie regelmäßig eine unnötige Belastung in Kauf genommen. Vor allem, wenn Frauen sich jährlich oder gar halbjährlich untersuchen lassen.
Einige Studien legen nahe, dass die Strahlung nicht nur Mutationen auslösen, sondern auch bereits vorhandene Tumorzellen aktivieren kann. Die Folge: Tumorwachstum und im schlimmsten Fall Metastasierung. Damit wird deutlich, dass die Mammographie mehr ist als ein harmloses Diagnosewerkzeug.

Die Schweiz zeigt: Es geht auch anders
Die Schweiz war das erste Land, das sich klar gegen eine generelle Empfehlung der Mammographie ausgesprochen hat. Bereits 2013 kam die Eidgenössische Kommission für allgemeine Gesundheitsfragen (EKGK) zu dem Schluss, dass der Nutzen in keinem Verhältnis zu den Risiken steht. Stattdessen riet man zu einer individuellen Risikobewertung und einem kritischen Umgang mit der Methode. Die Schweiz zeigt damit, dass eine aufgeklärte Gesundheitspolitik auch gegen etablierte Interessen vorgehen kann.
Die wirtschaftlichen Interessen hinter der Mammographie
Hinter der Mammographie steht ein milliardenschwerer Markt. Von der Untersuchung selbst über Biopsien bis hin zu aufwändigen Behandlungen im Falle einer Krebsdiagnose: Jeder Schritt generiert Umsatz. Es ist daher nicht verwunderlich, dass das Verfahren flächendeckend empfohlen wird.
Für Kliniken, Labore und Pharmaunternehmen sind Krebsdiagnosen lukrativ. Viele Mediziner erkennen das Problem jedoch erst spät. Einige berichten, dass sie gegen Ende ihrer Karriere erkannt haben, ungewollt Teil eines Systems gewesen zu sein, das gesunde Frauen in Patienten verwandelt. Die Mammographie ist damit nicht nur eine medizinische Frage, sondern auch ein ethisches Dilemma.
Die Mammographie im internationalen Vergleich
Während die Mammographie in vielen Ländern als Standardverfahren gilt, gibt es internationale Unterschiede in der Bewertung. In Deutschland etwa wird sie weiterhin aktiv gefördert. Dabei zeigen auch hier Studien, dass der Nutzen begrenzt und die Risiken hoch sind. Andere Länder, wie die Niederlande oder Norwegen, diskutieren mittlerweile offen über die Risiken und suchen nach Alternativen.
Diese internationale Debatte zeigt, dass es keineswegs einen medizinischen Konsens gibt. Vielmehr ist die Mammographie ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich wissenschaftliche Erkenntnisse bewertet und politisch umgesetzt werden.
Welche Alternativen gibt es?
Es gibt inzwischen mehrere risikoärmere Alternativen. Dazu zählen unter anderem die Thermografie und die Brustultraschalluntersuchung. Beide Methoden arbeiten ohne Strahlen und ohne mechanischen Druck. Sie können entzündliche Prozesse, Durchblutungsstörungen oder Gewebeveränderungen sichtbar machen, ohne dabei das Gewebe zu belasten.
Auch die regelmäßige Selbstuntersuchung sowie gezielte Blutanalysen und Hormonspiegel können wichtige Hinweise auf ein individuelles Risiko geben. In Kombination mit einer bewussten Lebensweise kann die Brustgesundheit damit wesentlich schonender und nachhaltiger erhalten werden als durch die Mammographie.

Der psychologische Faktor
Neben den physischen Risiken darf auch die psychologische Belastung nicht unterschätzt werden. Ein positiver Befund, selbst wenn er sich als falsch herausstellt, erzeugt Angst, Unsicherheit und Ohnmachtsgefühle. Frauen werden zu Patientinnen gemacht, ohne krank zu sein. Das Vertrauen in den eigenen Körper schwindet, oft dauerhaft.
Die Mammographie verändert das Selbstbild vieler Frauen. Aus präventivem Denken wird ein Zustand chronischer Besorgnis. Ein medizinisches Verfahren, das zur Beruhigung beitragen soll, schafft in Wirklichkeit Unruhe und Stress. Das ist ein Alarmzeichen.
Fazit: Mammographie – Risiko statt Rettung?
Die Mammographie ist ein medizinisches Verfahren mit vielen Risiken. Die hohe Zahl an Falschdiagnosen, die mechanische und strahlenbedingte Belastung sowie die damit verbundenen psychischen Folgen sprechen eine deutliche Sprache. Gleichzeitig gibt es Alternativen, die weniger belastend und deutlich schonender sind.
Die Mammographie muss daher neu bewertet werden. Frauen verdienen transparente Information, echte Wahlfreiheit und die Möglichkeit, sich für schonende und sichere Methoden zu entscheiden. Wer wirklich vorsorgen will, braucht Wissen – nicht Angst.
Die Mammographie steht sinnbildlich für eine Medizin, die nicht mehr dem Menschen dient, sondern wirtschaftlichen Interessen folgt. Es ist Zeit, dieses System zu hinterfragen.
Quellenangabe:
https://www.bild.de/tipps-trends/gesund-fit/auswirkungen-gesundheit-2250206.bild.html
https://healthcare-in-europe.com/de/news/mammografie-jede-dritte-brustkrebsdiagnose-harmlos.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/krankheiten/krebserkrankungen/falschdiagnosen