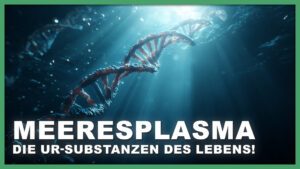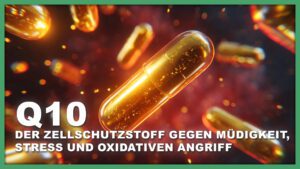Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran – und macht auch vor Arztpraxen nicht halt. Mit der zunehmenden Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) wird sich die Beziehung zwischen Arzt und Patient grundlegend verändern. Elektronische Datenverarbeitung, automatisierte Diagnosen und intelligente Assistenzsysteme sind längst keine Zukunftsmusik mehr, sondern beschlossene Realität. Doch was bedeutet das für Dich als Patient? Wird die menschliche Nähe im Gespräch verloren gehen – oder eröffnen sich ganz neue Chancen für eine präzisere und individuellere Medizin? Noch ist unklar, wie sich diese Entwicklung konkret auswirken wird. Sicher ist nur: Viele Menschen begegnen der digitalen Transformation im Gesundheitswesen mit Skepsis – und nicht ohne Grund.
➥ Autor: Niki Vogt
➥ Unsere Empfehlung: Digitalisierung in der Medizin

KI ist hilfreich – aber nicht unfehlbar
Zwar ist Dr. med. Google der bereits jetzt meistgefragte Arzt, denn wer von uns hat noch nicht aus Google nachgeschaut, was die Symptome, die wir gerade an uns feststellen und die uns verunsichern, denn bedeuten könnten. Du hast das bestimmt auch schon gemacht.
Ärzte berichten häufig, dass Patienten verunsichert oder sogar geschockt in die Praxis kommen. Grund ist meist eine Google-Suche oder eine Anfrage an die KI, die Ergebnisse aus unterschiedlichsten Quellen zusammenstellt – darunter oft auch Schockdiagnosen wie Krebs oder andere schwere Krankheiten.
In den allermeisten Fällen kann der Arzt jedoch nach gründlicher Untersuchung Entwarnung geben. Häufig handelt es sich um etwas Harmloses, das sich leicht behandeln lässt. Zum Beispiel: Kein drohender Herzinfarkt, sondern eine Nervenentzündung. Diese wird durch eine falsche Körperhaltung verursacht – etwa durch einen abgeknickten Nacken vor dem Bildschirm. Der betroffene Nerv zieht schmerzhaft vom Nacken bis zum linken Brustkorb, lässt sich aber gut beruhigen.
Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung im Gesundheitswesen erhält die KI zunehmend mehr Informationen: Laborwerte, Ultraschallbilder oder CT-Bilder, Fotos etc. – plus genaue Angaben von Arzt und Patient. Mit dieser Datenbasis liefert sie sehr präzise Diagnosen, das bestätigen mittlerweile viele Ärzte. Die Digitalisierung ermöglicht es der Künstlichen Intelligenz sogar, maßgeschneiderte Therapien anzubieten, wenn sie den Lebensstil, die Vorlieben und Abneigungen des Patienten kennt.
Chancen und Risiken der Digitalisierung
Die KI kann also nun dazu benutzt werden, dass Du genau das mit einer neuen „App“, also einem Programm schon zu Hause machen kannst und dann mit dieser Einschätzung zum Arzt gehst. Also zum Beispiel eine verdächtige Warze oder ein Muttermal in eine Hautkrebs-Screening-App einscannst und dann die Empfehlung von der KI bekommst, zu einem Hautarzt zu gehen.
Wie wird der Arzt reagieren? Wird er der KI so weit vertrauen, dass er kaum weitere Untersuchungen macht? Oder überprüft er trotzdem mit einer Gewebeprobe die KI-Diagnose? Dann hätte man ja gleich zu ihm gehen können. Und wenn die Diagnose der KI mit Zustimmung des Arztes ohne weitere Kontrolle falsch war? Dann hast Du schlechte Karten, wenn Du die Diagnose anzweifelst. Schlimmer noch: Wenn das dann in Deiner ePA (elektronischen Patientenakte) steht, ist der nächste Arzt vielleicht auch gleich voreingenommen.
Diese Entwicklung zeigt deutlich, wie stark die Digitalisierung bereits Einfluss auf medizinische Entscheidungsprozesse nimmt – und wie wichtig es ist, ihre Grenzen zu erkennen.

Vertrauen: Menschlicher Arzt oder künstliche Intelligenz?
Andererseits könnte es dazu führen, dass Patienten mit einer App-Diagnose zum Arzt gehen – und dessen abweichende Meinung ignorieren. Vielleicht halten sie ihn für „nicht mehr auf dem neuesten Stand“. Doch wem vertraut man mehr? Einer KI mit Zugang zu unzähligen Daten – oder dem menschlichen Arzt mit Erfahrung und Empathie?
Informationsflut, Unsicherheit und die Rolle der Pharmaindustrie
Schon, wenn Du nach Deinen Symptomen googelst, findest Du eine Menge oft widersprüchliche Informationen zu Deiner Frage. Da gibt es naturmedizinische Webseiten und von der Pharmaindustrie gesponserte, von Kliniken und Behörden – und jede sieht die Behandlungsmethoden anders. Die wenigsten Patienten sind in der Lage, das beurteilen zu können. Die einen beharren dann auf ihrer Meinung, andere sind völlig verunsichert: Ist die Naturheilkunde oft ein besserer Weg, den Menschen wieder zu heilen oder wirkt, wenn überhaupt, einfach nur der Glaube. Ist die moderne Medizin fast schon allmächtig und unfehlbar – oder werden wir da zum Objekt und in vielen Fällen nur vergiftet?
Der Einfluss der Digitalisierung auf Vertrauen und Kommunikation
Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung im Gesundheitswesen ist daher der richtige Umgang mit neuen Technologien entscheidend – sowohl für Ärzte als auch für Patienten.
Der Knackpunkt ist das Vertrauen. Wenn Ärzte KI-Diagnosen einfach als unanzweifelbar darstellen, werden Patienten leicht misstrauisch und zweifeln die Maschinen-Diagnose an. Der Arzt muss seinem Patienten vermitteln, dass er – und nur er – für Dich verantwortlich ist und die KI ein (vielleicht sehr gutes) „Werkzeug“ ist und auch bleibt. Und nicht den Arzt ersetzt.
Ärzte zwischen Skepsis, Überforderung und Konkurrenzdruck
Nicht wenige Ärzte sehen diese Technologien mit Unbehagen.
Sehr viele alteingesessene Ärzte mit viel praktischer Erfahrung und Menschenkenntnis sind nicht begeistert von den technischen Neuerungen. Sie kennen als Hausarzt ihren Patientenstamm und deren Lebensführung und persönlichen Hintergrund. Das macht eine Diagnose schon einfacher.
Andererseits herrscht bei den Ärzten teilweise auch eine gewisse Konkurrenz-Sorge. Sie wollen sich auch ungern mit diesen Neuerungen auseinandersetzen. Unsere Abdeckung an Arztpraxen ist jetzt schon zu dünn. Wenn nun noch viele ältere Ärzte und Ärztinnen beschließen, dass sie diesen „elektronischen Schnickschnack“ gar nicht erst erlernen wollen und beschließen, in den Ruhestand zu treten, dann wird es schwierig werden mit der medizinischen Versorgung.
Wirtschaftlicher Druck durch die Digitalisierung im Gesundheitswesen
Gerade durch die zunehmende Digitalisierung des Gesundheitssystems fühlen sich viele Ärztinnen und Ärzte unter Druck gesetzt. Es entsteht ein wirtschaftlicher Zwang, mit den technologischen Entwicklungen Schritt zu halten – ob gewollt oder nicht.
Dazu kommt noch die Gefahr, dass die Arztpraxen sich wahrscheinlich mehr oder weniger gezwungen sehen, diese teuren Technologien einzusetzen, um nicht aus dem Geschäft gedrängt zu werden von denen, die so etwas haben.
Patientendaten, Krankenkassen und die Angst vor Kontrolle
Auf der Seite der Patienten – und das sind wir alle nunmal mehr oder weniger oft – wird die Sorge geäußert, dass die Krankenkassen nun eine wesentlich wichtigere Rolle spielen werden. Sie bekommen im Rahmen der ePA (elektronischen Patientenakte) viel mehr Zugang zu allen Daten der Patienten und damit mehr Möglichkeiten, sich einzumischen, den Versicherten Vorschriften zu machen und möglicherweise Behandlungen, die der Patient wünscht, abzulehnen, weil es preiswertere Behandlungsmöglichkeiten gibt, die die KI freundlicherweise neben einigen anderen aufgelistet hat – und eben auch neben der, die Du haben willst, die aber teurer ist.
Umgekehrt hat die KI Zugriff auf alle Daten aus Deiner ePA. Viele sehen darin den Menschen nur noch als Träger von Daten und Möglichkeiten für Umsatz und Gewinne des Gesundheitssystems, der Pharmaindustrie und den großen Kliniken mit ihren superteuren Geräten.
Die Digitalisierung könnte somit – neben vielen potenziellen Vorteilen – auch das Arzt-Patient-Verhältnis grundlegend verändern und das Vertrauen in eine individuelle, menschliche Betreuung infrage stellen.

Wie unfehlbar ist die KI?
Da die KI völlig unvoreingenommen vorschlägt, was sie bei ihrer Suche durch das „weltweite Internet“ findet, entsteht eine neue Gefahr: Kleine, neue medizinische Start-ups können sich einmischen – vorausgesetzt, sie treten überzeugend im Netz auf. Mit abenteuerlichen Geschäftsmodellen erzielen sie oft schnell hohe Umsätze und verschwinden wieder, wenn sich ihre Methoden als unwirksam oder sogar schädlich herausstellen.
Auch große Tech-Konzerne können mit geschickten Strategien einen Hype um ihre Geräte erzeugen. Die KI wird solche Produkte dann deutlich häufiger empfehlen. Oft geschieht das unauffällig: Kommerzielle Akteure im Gesundheitswesen – etwa Pharmafirmen, Medizintechnik-Hersteller, Kliniken oder Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln – nutzen KI-Empfehlungen gezielt für ihre Zwecke.
Geeignete Maßnahmen wie positive Berichte in Fachzeitschriften, Erfahrungsberichte von Patienten oder bezahlte Pressemeldungen beeinflussen zusätzlich das Ranking. Solche Inhalte tauchen dadurch wahrscheinlicher in den Vorschlägen der KI auf.
Kurz: jede Arte von kommerziellen Interessenten wird diese neue Struktur des Gesundheitswesens für sich nutzen. Bis das System darauf reagiert und effektive Gegenmaßnahmen ergreift, kann viel Zeit vergehen und viel Schaden getan werden.

Der menschliche Kontakt ist nicht zu ersetzen
Dein Arzt, der Dich kennt, wird wahrscheinlich nicht immer dem Rat der KI folgen. Möglicherweise empfiehlt er Dir sogar eine homöopathische Behandlung oder „nur“ eine Veränderung Deiner Lebensweise. Weil er Deine persönliche Situation kennt, erkennt er vielleicht auch, dass Deine Beschwerden seelischer Natur sind und Du einfach wieder mehr in Deine Mitte finden musst. Es könnte sein, dass Liebeskummer hinter Deinen Symptomen steckt – und anstatt Dir Psychopharmaka oder eine Therapie zu verordnen, rät er Dir zu sanften Naturheilmitteln gegen Deine Schlafstörungen. Doch wie wird sich das auf ihn auswirken? Akzeptiert das ePA-System überhaupt solch individuelle „Behandlungen“?
Je nachdem, welches Gesundheitsproblem Du hast, wirst Du unter Umständen einen Facharzt aufsuchen müssen – jemanden, der Dich nicht kennt. Ein solcher Arzt, der stark auf KI vertraut, könnte subjektive Schilderungen übergehen und sich nur an die Algorithmen halten, was das Vertrauen erheblich beeinträchtigen kann.
Gerade im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung des Gesundheitswesens besteht die Gefahr, dass persönliche Feinfühligkeit durch standardisierte Bewertungen ersetzt wird.
Er wird vielleicht die Empfehlungen der KI einfach übernehmen, weil er im Zeitdruck ist oder weil er auf die so hochgelobten, hochpräzise Diagnosen der KI vertraut. Und doch ist es möglich, dass diese KI-Diagnose aufgrund von unvollständigen Daten zustande gekommen ist. Oder dass es sich um eine sehr seltene Erkrankung handelt, die sie nicht erkennt. Oder, wie schon gesagt, der wahre Grund für Deine Krankheitssymptome seelischer Natur ist. Dann ist es die menschlich einfühlsame Kompetenz des Arztes, die hier unersetzlich ist.
Die Digitalisierung kann also zwar Diagnoseprozesse beschleunigen und Daten effizienter erfassen – doch sie darf den empathischen Blick des Arztes auf den Menschen nicht ersetzen.
Es muss also immer noch eine Einschätzung der Persönlichkeit des Patienten, einfühlsames Nachfragen und eine Einschätzung des Arztes mitwirken: Ist das ein trauriger, scheuer, ängstlicher Mensch, der da sitzt? Gibt die Person offen und ehrlich Antworten auf seine Fragen? Macht der Patient den Eindruck eines Hypochonders? Oder spielt er/sie den Helden?